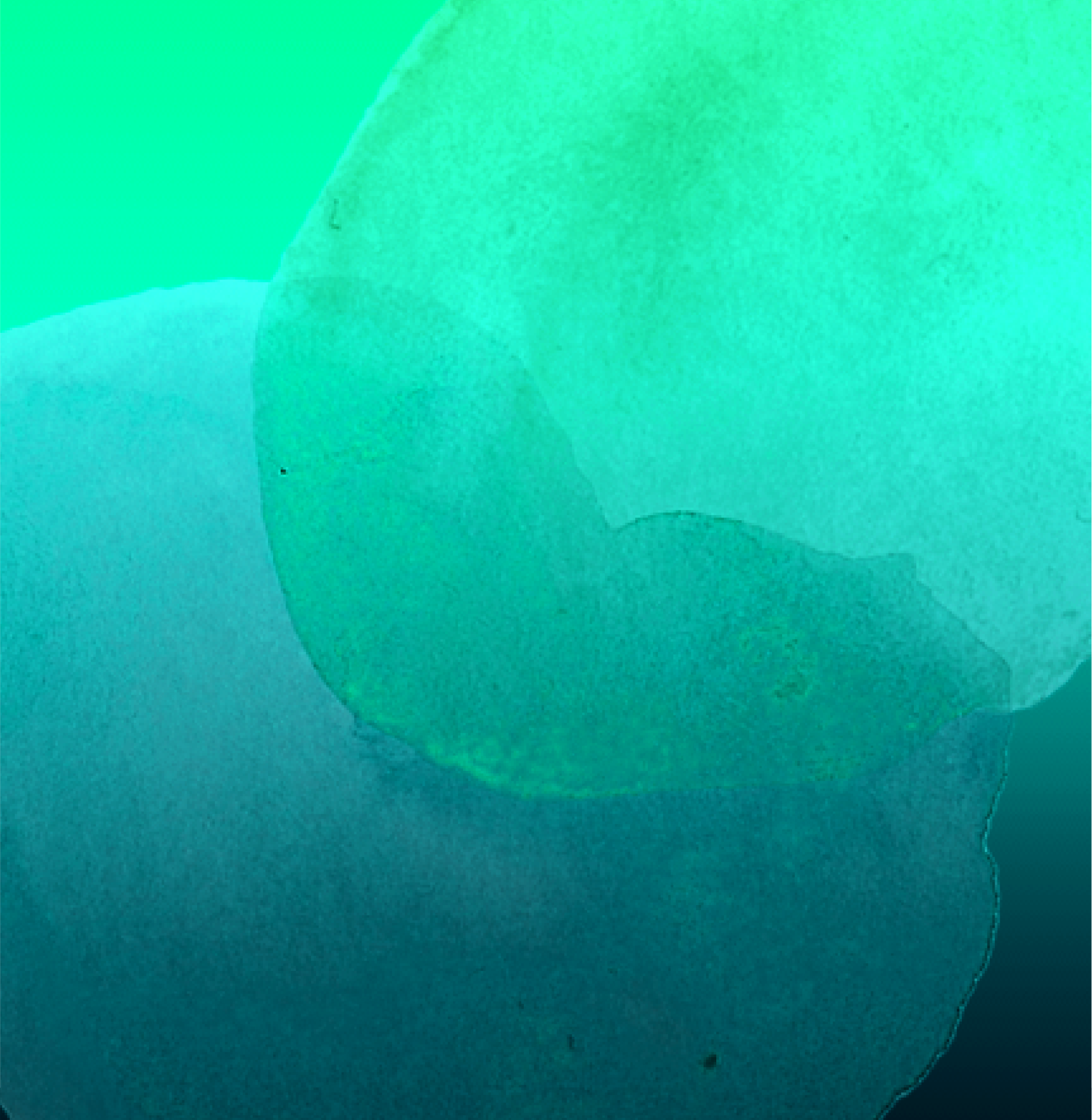Vom Hunger einer übersättigten Gesellschaft
09.03.2025 - 20:54 Uhr
Man könnte meinen, es stehe mir nicht zu, über Hunger zu schreiben. Ich lebe in einer Welt voller Luxus, in der ich morgens zwischen Marmelade, Müsli und Rührei wähle, nachmittags zum White Moccachino Karamell-Flavored Dingsbums noch ein Stück Käsekuchen verdrücke und abends entscheide, ob es Steak oder Pasta sein soll. Falls mir doch mal etwas fehlen sollte, gibt es Ernährungsberatung, Nahrungsergänzungsmittel, Detox-Kuren. Alles safe. Ich bin privilegiert und satt.
Und doch – da ist etwas, das sich nicht sättigen lässt. Ein nagender Mangel, den kein voller Teller besänftigt. Der Hunger, von dem ich spreche, ist nicht der, der in meinem leeren Magen rumort. Es ist der Hunger nach etwas Tieferem. Nach Wahrnehmung. Nach Nähe. Nach echter Verbindung, die nicht konsumierbar ist und die mich trägt. Ich suche etwas Echtes, das bleibt.
Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich das Wort Hunger dafür gebrauchen darf, denn da erscheinen Bilder von ausgemergelten Körpern und hungernden Menschen, die an Armut leiden, ums Überleben kämpfen. In einer Welt, in der täglich Menschen sterben, weil sie nichts zu essen haben, scheint es fast zynisch, über unseren „Hauthunger“ zu sprechen. Dürfen wir das? Darf ich von Mangel reden, wenn ich die Wahl zwischen fünf verschiedenen Pflanzenmilchsorten habe?
Ja. Weil dieser Hunger real ist.
Nicht weniger schlimm, nur anders. Der körperliche Hunger ist ein Grauen, das niemals relativierbar sein wird.
Doch es gibt eine Hungersnot der Seele, die unbemerkt bleibt. Sie tarnt sich als Überfluss. Sie schleicht sich ein, während wir glauben, dass mehr uns füllt – mehr Erlebnisse, mehr Dinge, mehr Erfolge. Aber wir sind längst überfüttert. Wir konsumieren rastlos, stimulieren uns bis zur Erschöpfung und bleiben trotzdem leer. Körperlich übersättigt, seelisch ausgehungert.
Es ist unangenehm, über Einsamkeit oder seelischen Hunger zu sprechen. Weil es nach Defizit klingt, irgendwie auch nach einem Eingeständnis. Nach Versagen. Es fällt schwer zuzugeben, dass etwas fehlt – obwohl doch eigentlich alles da ist.
Also lenke ich mich ab. Ich mache mit, wie alles es tun. Mit Aufgaben, die mich fordern, aber nicht erfüllen. Mit Meetings, Podcasts, Fitness-Apps, weil Stillstand ja Rückschritt ist. Mit Menschen, die mir nah sein sollten, aber an denen ich trotzdem vorbei lebe. Ich kaufe Dinge, die mich für drei Minuten glücklich machen. Starre auf Bildschirme, scrolle, streame, snacke – Hauptsache, ich muss nicht fühlen, was mir unter die Haut geht.
Und doch ist es da. Das leise Ziehen in der Brust. Die Unruhe. Das Gefühl, als wäre da ein Loch, das sich nicht stopfen lässt. Schokolade hilft kurz. Ein Anruf macht´s erträglicher. Ein paar Likes, ein kurzer Dopamin-Kick flickt notdürftig, was längst Risse hat. Aber all das hält nicht.
Was wir überdecken, holt uns irgendwann ein.
Er frisst uns genauso auf wie körperlicher Mangel – nur leiser, schleichender, unbemerkter. Wer zu wenig isst, dessen Körper beginnt, sich selbst zu verzehren. Muskeln schwinden, Organe versagen, das Herz wird schwächer. Wer dauerhaft keine echte Nähe oder Berührung erfährt, dem fehlt im übertragenen Sinne ein lebenswichtiges Grundnahrungsmittel. Isolation schwächt das Immunsystem, lässt den Cortisolspiegel steigen, fördert Entzündungen, erhöht das Risiko für Herzkrankheiten, Depressionen, Demenz.
Ein verhungernder Körper sendet anfangs noch Signale – Magenschmerzen, Zittern, Kreislaufprobleme. Doch irgendwann gibt er auf, der Appetit verschwindet, und mit ihm das Gespür für das eigene Bedürfnis nach Nahrung. Die Seele verhält sich genauso: Wer zu lange ohne echte Berührung lebt, spürt irgendwann nicht einmal mehr, dass ihm etwas fehlt. Bis er abstumpft. Oder krank wird.
Doch warum übersehen wir diesen Hunger noch immer? Warum tun wir so, als könnten wir ihn mit noch mehr Konsum, der nächsten Work-Life-Balance-Routine oder einem weiteren „ganzheitlichen“ Konzept stillen? Es ist doch eigentlich einfach.
Wir haben Hunger darauf, wahrgenommen zu werden. Nicht nur Teil der Masse zu sein, sondern gesehen, gespürt, gehalten zu werden. Wir hungern nach Verbindungen, die mehr sind als bloße Kontakte. Nach Gesprächen, die uns berühren. Nach Körperkontakt, der uns nährt. Wir brauchen das Gefühl, dass unsere Existenz einen Sinn und einen Kontext hat.
Und doch erleben viele von uns das Gegenteil: Der Magen ist voll, die Couch bequem – im Hintergrund surrt leise und unaufhörlich ein Fehlen. Diese „Sättigung“ fühlt sich nicht nach Zufriedenheit an. Man könnte sagen, wir leben in einer Gesellschaft, die sich selbst auf emotionale Sparflamme gesetzt hat. Wir haben Zugang zu allem, konsumieren unaufhörlich – und doch fehlen uns die entscheidenden Dinge.
Lange dachte ich, dieses Fehlen sei etwas Persönliches. Mein eigenes, individuelles Problem, das ich allein lösen müsste. Ein alter Glaubenssatz, eine transgenerationale Weitergabe, ein dysfunktionales Mangelbewusstsein. Doch je mehr ich hinsah und den Menschen Fragen stellte, desto deutlicher wurde: Es ist nicht nur meine Leere. Ich sehe sie überall. Es ist unsere.
Wir leben in einer Gesellschaft, die Fülle mit Erfüllung verwechselt – die uns glauben lässt, dass wir alles selbst in der Hand haben, solange wir nur diszipliniert genug an uns arbeiten. Doch wie sollen wir seelisch satt werden, wenn Nähe zur Mangelware wird? Wenn Berührung nicht mehr selbstverständlich ist, sondern zur kalkulierten Geste oder erwartungsbeladener Performance verkommt? Wenn echte Gespräche in Sprachnachrichten zerfallen und Leistung mehr zählt als Gemeinschaft und Zugehörigkeit?
Es ist ein strukturelles Problem. Eine Kultur, die auf permanente Leistung ausgelegt ist, die Selbstoptimierung predigt, aber das Essenziellste vernachlässigt: echte Verbindung.
Ich erinnere mich an viele Menschen mit Essstörungen, die ich in der Klinik begleiten durfte, und an all jene, die nie eine offizielle Diagnose hatten, aber trotzdem keinen Frieden fanden – weder mit dem Essen noch mit sich selbst und ihrem Körper. Essstörungen sind komplexe Krankheitsbilder, die weit über eine problematische Beziehung zur Nahrung hinausgehen. Aber eine Erkenntnis blieb mir über all die Jahre: Im Kern ging es bei diesen Menschen immer um dasselbe – um den stillen, quälenden Konflikt, vor vollen Trögen zu verhungern.
Diese Menschen lehrten mich eine bittere Wahrheit: Man kann inmitten von Überfluss verhungern – nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Denn was wirklich nährt, ist nicht das unaufhörliche Streben nach Erfolg und Anerkennung, nicht die perfekte Selbstoptimierung oder das nächste große Ziel.
Ich wünschte, ich könnte sagen, dass es eine einfache Lösung gibt. Ein Rezept, eine Therapie, eine Methode. Aber ich glaube nicht, dass dieser Hunger sich mit Konzepten stillen lässt. Ich glaube, es fängt damit an, ihn überhaupt zuzulassen. Ihn nicht zu betäuben, nicht wegzudrücken. Mich zu fragen: Wonach hungere ich wirklich? Ist es Bestätigung? Berührung? Ruhe?
Und dann – statt ihn mit jedem greifbaren Ersatz zu füllen – mich dem echten Bedürfnis zuzuwenden. Vielleicht heißt das, eine Umarmung auszuhalten, die ich sonst zu früh löse. Mich jemandem wirklich zu öffnen, ohne sofort eine Rolle zu spielen. Einen Moment der Stille nicht zu übergehen, sondern zu spüren, was er mit mir macht.
Aber auch: Uns als Gesellschaft zu fragen, welche Strukturen diesen Mangel erst erschaffen. Wo wir Raum für echte Begegnung verloren haben. Und wie wir ihn zurückholen können.
Vielleicht ist das ein Anfang.
Und genau danach will ich suchen.
Und doch – da ist etwas, das sich nicht sättigen lässt. Ein nagender Mangel, den kein voller Teller besänftigt. Der Hunger, von dem ich spreche, ist nicht der, der in meinem leeren Magen rumort. Es ist der Hunger nach etwas Tieferem. Nach Wahrnehmung. Nach Nähe. Nach echter Verbindung, die nicht konsumierbar ist und die mich trägt. Ich suche etwas Echtes, das bleibt.
Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich das Wort Hunger dafür gebrauchen darf, denn da erscheinen Bilder von ausgemergelten Körpern und hungernden Menschen, die an Armut leiden, ums Überleben kämpfen. In einer Welt, in der täglich Menschen sterben, weil sie nichts zu essen haben, scheint es fast zynisch, über unseren „Hauthunger“ zu sprechen. Dürfen wir das? Darf ich von Mangel reden, wenn ich die Wahl zwischen fünf verschiedenen Pflanzenmilchsorten habe?
Ja. Weil dieser Hunger real ist.
Nicht weniger schlimm, nur anders. Der körperliche Hunger ist ein Grauen, das niemals relativierbar sein wird.
Doch es gibt eine Hungersnot der Seele, die unbemerkt bleibt. Sie tarnt sich als Überfluss. Sie schleicht sich ein, während wir glauben, dass mehr uns füllt – mehr Erlebnisse, mehr Dinge, mehr Erfolge. Aber wir sind längst überfüttert. Wir konsumieren rastlos, stimulieren uns bis zur Erschöpfung und bleiben trotzdem leer. Körperlich übersättigt, seelisch ausgehungert.
Die Leere lässt sich nicht stopfen.
Es ist unangenehm, über Einsamkeit oder seelischen Hunger zu sprechen. Weil es nach Defizit klingt, irgendwie auch nach einem Eingeständnis. Nach Versagen. Es fällt schwer zuzugeben, dass etwas fehlt – obwohl doch eigentlich alles da ist.
Also lenke ich mich ab. Ich mache mit, wie alles es tun. Mit Aufgaben, die mich fordern, aber nicht erfüllen. Mit Meetings, Podcasts, Fitness-Apps, weil Stillstand ja Rückschritt ist. Mit Menschen, die mir nah sein sollten, aber an denen ich trotzdem vorbei lebe. Ich kaufe Dinge, die mich für drei Minuten glücklich machen. Starre auf Bildschirme, scrolle, streame, snacke – Hauptsache, ich muss nicht fühlen, was mir unter die Haut geht.
Und doch ist es da. Das leise Ziehen in der Brust. Die Unruhe. Das Gefühl, als wäre da ein Loch, das sich nicht stopfen lässt. Schokolade hilft kurz. Ein Anruf macht´s erträglicher. Ein paar Likes, ein kurzer Dopamin-Kick flickt notdürftig, was längst Risse hat. Aber all das hält nicht.
Was wir überdecken, holt uns irgendwann ein.
Denn Seelenhunger ist nicht harmlos.
Er frisst uns genauso auf wie körperlicher Mangel – nur leiser, schleichender, unbemerkter. Wer zu wenig isst, dessen Körper beginnt, sich selbst zu verzehren. Muskeln schwinden, Organe versagen, das Herz wird schwächer. Wer dauerhaft keine echte Nähe oder Berührung erfährt, dem fehlt im übertragenen Sinne ein lebenswichtiges Grundnahrungsmittel. Isolation schwächt das Immunsystem, lässt den Cortisolspiegel steigen, fördert Entzündungen, erhöht das Risiko für Herzkrankheiten, Depressionen, Demenz.
Ein verhungernder Körper sendet anfangs noch Signale – Magenschmerzen, Zittern, Kreislaufprobleme. Doch irgendwann gibt er auf, der Appetit verschwindet, und mit ihm das Gespür für das eigene Bedürfnis nach Nahrung. Die Seele verhält sich genauso: Wer zu lange ohne echte Berührung lebt, spürt irgendwann nicht einmal mehr, dass ihm etwas fehlt. Bis er abstumpft. Oder krank wird.
Doch warum übersehen wir diesen Hunger noch immer? Warum tun wir so, als könnten wir ihn mit noch mehr Konsum, der nächsten Work-Life-Balance-Routine oder einem weiteren „ganzheitlichen“ Konzept stillen? Es ist doch eigentlich einfach.
Wir haben Hunger darauf, wahrgenommen zu werden. Nicht nur Teil der Masse zu sein, sondern gesehen, gespürt, gehalten zu werden. Wir hungern nach Verbindungen, die mehr sind als bloße Kontakte. Nach Gesprächen, die uns berühren. Nach Körperkontakt, der uns nährt. Wir brauchen das Gefühl, dass unsere Existenz einen Sinn und einen Kontext hat.
Und doch erleben viele von uns das Gegenteil: Der Magen ist voll, die Couch bequem – im Hintergrund surrt leise und unaufhörlich ein Fehlen. Diese „Sättigung“ fühlt sich nicht nach Zufriedenheit an. Man könnte sagen, wir leben in einer Gesellschaft, die sich selbst auf emotionale Sparflamme gesetzt hat. Wir haben Zugang zu allem, konsumieren unaufhörlich – und doch fehlen uns die entscheidenden Dinge.
Wir verwechseln Fülle mit Erfüllung.
Lange dachte ich, dieses Fehlen sei etwas Persönliches. Mein eigenes, individuelles Problem, das ich allein lösen müsste. Ein alter Glaubenssatz, eine transgenerationale Weitergabe, ein dysfunktionales Mangelbewusstsein. Doch je mehr ich hinsah und den Menschen Fragen stellte, desto deutlicher wurde: Es ist nicht nur meine Leere. Ich sehe sie überall. Es ist unsere.
Wir leben in einer Gesellschaft, die Fülle mit Erfüllung verwechselt – die uns glauben lässt, dass wir alles selbst in der Hand haben, solange wir nur diszipliniert genug an uns arbeiten. Doch wie sollen wir seelisch satt werden, wenn Nähe zur Mangelware wird? Wenn Berührung nicht mehr selbstverständlich ist, sondern zur kalkulierten Geste oder erwartungsbeladener Performance verkommt? Wenn echte Gespräche in Sprachnachrichten zerfallen und Leistung mehr zählt als Gemeinschaft und Zugehörigkeit?
Es ist ein strukturelles Problem. Eine Kultur, die auf permanente Leistung ausgelegt ist, die Selbstoptimierung predigt, aber das Essenziellste vernachlässigt: echte Verbindung.
Ich erinnere mich an viele Menschen mit Essstörungen, die ich in der Klinik begleiten durfte, und an all jene, die nie eine offizielle Diagnose hatten, aber trotzdem keinen Frieden fanden – weder mit dem Essen noch mit sich selbst und ihrem Körper. Essstörungen sind komplexe Krankheitsbilder, die weit über eine problematische Beziehung zur Nahrung hinausgehen. Aber eine Erkenntnis blieb mir über all die Jahre: Im Kern ging es bei diesen Menschen immer um dasselbe – um den stillen, quälenden Konflikt, vor vollen Trögen zu verhungern.
Diese Menschen lehrten mich eine bittere Wahrheit: Man kann inmitten von Überfluss verhungern – nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Denn was wirklich nährt, ist nicht das unaufhörliche Streben nach Erfolg und Anerkennung, nicht die perfekte Selbstoptimierung oder das nächste große Ziel.
Was uns wirklich nährt, ist Berührung, die uns wach macht. Nähe, die uns heilt. Verbindung, die uns spüren lässt, dass wir nicht allein sind.
Ich wünschte, ich könnte sagen, dass es eine einfache Lösung gibt. Ein Rezept, eine Therapie, eine Methode. Aber ich glaube nicht, dass dieser Hunger sich mit Konzepten stillen lässt. Ich glaube, es fängt damit an, ihn überhaupt zuzulassen. Ihn nicht zu betäuben, nicht wegzudrücken. Mich zu fragen: Wonach hungere ich wirklich? Ist es Bestätigung? Berührung? Ruhe?
Und dann – statt ihn mit jedem greifbaren Ersatz zu füllen – mich dem echten Bedürfnis zuzuwenden. Vielleicht heißt das, eine Umarmung auszuhalten, die ich sonst zu früh löse. Mich jemandem wirklich zu öffnen, ohne sofort eine Rolle zu spielen. Einen Moment der Stille nicht zu übergehen, sondern zu spüren, was er mit mir macht.
Aber auch: Uns als Gesellschaft zu fragen, welche Strukturen diesen Mangel erst erschaffen. Wo wir Raum für echte Begegnung verloren haben. Und wie wir ihn zurückholen können.
Vielleicht ist das ein Anfang.
Sattsein fühlt sich anders an als Fülle. Es ist nicht das „Mehr“, sondern das „Genug“.
Und genau danach will ich suchen.